Ausleihe und Bibliothekstantieme
Kapitel 10.2.9 in Auflage 86
| 10.2.9.1 | Die Ausleihe |
| 10.2.9.2 | Die Bibliothekstantieme |
| 10.2.9.2.0 | Literatur zur Bibliothekstantieme |
| 10.2.9.2.1 | Entwicklung |
| 10.2.9.2.2 | Vergütungspflicht |
| 10.2.9.2.3 | Finanzierung |
| 10.2.9.2.4 | Ausschüttung durch die VG Wort |
| 10.2.9.2.5 | Vergütung für Ausleihen in Öffentlichen Bibliotheken |
| 10.2.9.2.6 | Vergütung für Ausleihen in wissenschaftlichen Bibliotheken |
| 10.2.9.2.7 | Kritik, Diskussion und Ausblick |
Zitationsverweis
: »Ausleihe und Bibliothekstantieme« (In: Erfolgreiches Management von Bibliotheken und Informationseinrichtungen, hrsg. von , Auflage 86, Hamburg: Verlag Dashöfer 2024, Abschn. 10.2.9)
Dies ist ein kostenfreier Fachartikel
Sie möchten mit mehr News und Fachinhalten up-to-Date bleiben?
Abonnieren Sie jetzt unseren kostenfreien Newsletter!10.2.9.1 Die Ausleihe
Urheberrechtlich ist die Leihe von Medien eine Verbreitungshandlung nach § 17 Abs. 1 UrhG. Das Verbreiten zählt zu den ausschließlichen Verwertungsrechten eines Urhebers (§ 15 Abs. 1 UrhG). Demzufolge ist das Verleihen dem Grundsatz nach nur mit Zustimmung des Urhebers/BerechtigtenAls Berechtigte werden alle Rechtsinhaber bezeichnet, die neben dem Urheber Rechtsschutz genießen (z. B. Verlage, Hersteller, Erben). statthaft. Gemäß § 17 Abs. 2 und § 69c UrhG erschöpft sich das Verbreitungsrecht, wenn das Original oder Vervielfältigungsstück mit Zustimmung eines Urhebers oder eines anderen Berechtigten in den Verkehr gebracht wird. Deshalb können Medien, die gekauft wurden bzw. Schenkungen, die man auch käuflich erwerben kann oder konnte, ohne Zustimmung eines Berechtigten weiterverbreitet werden. Für die massenhafte Verbreitung regelt § 27 UrhG den Interessenausgleich, indem der Gesetzgeber für das Verleihen durch öffentlich zugängliche Einrichtungen wie Bibliotheken eine Entschädigung Bibliothekstantieme(Bibliothekstantieme) einführte. Diese wird durch Bund und Länder an die Verwertungsgesellschaften auf der Grundlage eines GesamtvertragesGesamtvertrag über die Abgeltung der Ansprüche nach § 27 Abs. 2 UrhG (Bibliothekstantieme) https://www.bibliotheksverband.de/fileadmin/user_upload/DBV/vereinbarungen/200330_GesamtV_27UrhG_2020 f.pdf [abgerufen am 21.08.2021] entrichtet. Die Bibliothekstantieme entspricht derzeit in etwa 4 Cent pro Ausleihe eines Buches oder 8 Cent für alle anderen Medien („Non-Books“).
Verliehen werden dürfen nicht nur Bücher, sondern auch alle anderen Medien auf physischen Trägern, also beispielsweise Spiele, Kunstwerke, DVDs, CDs etc. Für Betriebssysteme und Standardsoftware wie etwa Microsoft Office-Programme gibt es allerdings eine Selbstverpflichtung der Bibliotheken, diese nicht in den Verleih zu nehmen.In den meisten Fällen wäre mit dem bloßen Verleih von Datenträgen mit komplexeren Computerprogrammen die zur erlaubten Nutzung nötige Lizenz sowieso nicht umfasst. Daher scheidet der Verleih von solchen Computerprogrammen schon aus ganz praktischen Gründen für Bibliotheken aus.
Sehr häufig befinden sich auf CDs, CD-ROMs und DVDsCDs, CD-ROMs und DVDs Aufdrucke „das Verleihen ist nicht gestattet“, obwohl das Medium zum Kauf angeboten wird. Dieser Aufdruck hat keine Rechtswirkung für Bibliotheken und Informationseinrichtungen, wenn die Medien unentgeltlich verliehen werden. Nach der Begründung zu § 27 UrhG ist die Ausleihe auch dann unentgeltlich, wenn dafür Gebühren oder Entgelte erhoben werden, soweit diese nicht die Kostendeckungsgrenze überschreiten. Ebenso haben die meisten sogenannten SchutzhüllenverträgeSchutzhüllenverträge keine Rechtsbindung.
Das Überspielen auf einen E-Book-ReaderÜberspielen von Texten und Daten auf einen E-Book-Reader stellt eine Vervielfältigungshandlung dar. Diese muss entweder durch einen Lizenzvertrag eingeräumt sein oder es muss eine der oben dargestellten (10.2.1) gesetzlichen Erlaubnisse greifen.
Bei der „Onleihe“, also der Bereitstellung von E-Medien ohne physischen Träger als Download oder Streaming für eine gewisse „Leihfrist“, handelt es sich um keine Ausleihe im Sinne von §§ 17 Abs. 2, 27 Abs. 2 UrhG. Sie ist somit auch nicht Gegenstand des Gesamtvertrags mit der VG Wort. Rechtlich ist eine „Onleihe“ nur mit Zustimmung der Rechteinhaber möglich. Viele Verlage haben mit der DiviBib GmbH der ekz- Gruppe oder der Firma OverDrive Verträge geschlossen, die es Bibliotheken gestatten, gegen Zahlung Werke aus dem jeweiligen Verlagsprogramm im Rahmen der „Onleihe“ zu verleihen.
Zusammenfassung zur Ausleihe
-
Das Verleihen käuflich zu erwerbender Medien auf physischen Trägern, selbst wenn diese elektronisch sind (USB-Stick, CD-ROM, DVD etc.), ist nach dem Erschöpfungsgrundsatz ohne Zustimmung zulässig.
-
Computerprogramme dürfen ebenfalls entliehen werden, wenn es sich nicht um Betriebssysteme und Standardsoftware handelt.
-
Bei der „Onleihe“, also der Bereitstellung von E-Medien ohne physischen Träger als Download oder Streaming für eine gewisse „Leihfrist“, handelt es sich um keine Ausleihe im Sinne von §§ 17 Abs.2, 27 Abs. 2 UrhG.
-
Medien, die nicht mit Zustimmung der Berechtigten in den Verkehr gebracht wurden, wie z. B. Briefe und andere Handschriften, sowie Medien, an denen kein Eigentum erworben wird (Lizenz- bzw. Nutzungsverträge), dürfen nicht ohne ausdrückliche Zustimmung verliehen werden.
-
Für das Entleihen durch die der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen entrichten Bund und Länder die Bibliothekstantieme auf der Grundlage der Deutschen Bibliotheksstatistik. Die immer wieder von einigen Anbietern direkt bei der geforderte Ausleihgebühr nicht durch Bibliothek zu entrichtenBibliothek geforderte Ausleihgebühr ist nicht durch die Bibliotheken zu entrichten!
10.2.9.2 Die Bibliothekstantieme
10.2.9.2.0 Literatur zur Bibliothekstantieme
Dünnwald, Rolf; Staats, Robert, 2021: Die Verleihtantieme („Bibliothekstantieme“) in: Loewenheim, Ulrich, Hrsg.: Handbuch des Urheberrechts, 3. Aufl., München: C. H. Beck, ISBN 978-3-406-72083-3, S. 2422–2440.
Keiderling, Thomas, 2011: Verwertungsgesellschaft WORT (VG WORT), in: Historisches Lexikon Bayerns, http://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Verwertungsgesellschaft_WORT_(VG_WORT), Zugriff: 13.03.2024.
Schmitt, Irmgard, 2008: Öffentliche Bibliotheken und Bibliothekstantieme in Deutschland. In: Bibliotheksforum Bayern, S. 153–157, https://www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/2008-3/BFB_0308_05_Schmitt_V04.pdf, Zugriff: 13.03.2024.
Verch, Ulrike (2023): Alles was Recht ist: Die Bibliothekstantieme, in: API Magazin 4 (2), https://doi.org/10.15460/apimagazin.2023.4.2.160, Zugriff: 13.03.2024.
10.2.9.2.1 Entwicklung
Einführung der Bibliothekstantieme im Jahr 1972Als 1965 das Urheberrechtsgesetz (UrhG)Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (Urheberrechtsgesetz) vom 09.09.1965 (BGBl. I S. 1273), zuletzt geändert am 23.06.2021. in Kraft trat, enthielt es noch keine Regelung, die eine finanzielle Vergütung für das kostenlose Ausleihen urheberrechtlich geschützter Werke in öffentlichen Bibliotheken vorschrieb. Diese wurde erst sieben Jahre später eingeführt, u. a. um die soziale Lage von Autorinnen und Autoren zu verbessern und die Einnahmen aus der neuen Bibliothekstantieme für deren Krankenversicherung und Pensionskasse zu nutzen.Schmitt, Irmgard, 2008: Öffentliche Bibliotheken und Bibliothekstantieme in Deutschland. In: Bibliotheksforum Bayern, S. 154, https://www.bibliotheksforum-bayern.de/fileadmin/archiv/2008-3/BFB_0308_05_Schmitt_V04.pdf, Zugriff: 13.03.2024. Zuvor hatten Urheber in Karlsruhe vergeblich eine Verfassungsbeschwerde dagegen erhoben, dass eine Vergütung nur dann erfolgt, wenn Bücher zu Erwerbszwecken vermietet, jedoch BVerfG: keine Notwendigkeit einer Vergütungspflicht für Bibliotheksausleihenicht kostenlos in öffentlichen Bibliotheken verliehen werden. Und obgleich das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 1971 entschied, dass der Gesetzgeber verfassungsrechtlich nicht verpflichtet ist, für jeden Fall einer Ausleihe den sog. Bibliotheksgroschen zu gewähren,BVerfG, Beschluss vom 07.07.1971, Az. 1 BvR 764/6. wurde die Vergütungspflicht für unentgeltliche Ausleihen nur ein Jahr später durch die Novellierung des UrheberrechtsgesetzesGesetz zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 10.11.1972, BGBl. S. 2081. verpflichtend eingeführt und ist bis heute in Kraft.
10.2.9.2.2 Vergütungspflicht
Das Recht von Autorinnen und Autoren, eine Zahlung für die massenhafte Nutzung ihrer Werke durch Bibliotheksausleihen zu erhalten, ergibt sich aus § 27 Abs. 2 UrhG, auch wenn dort der Begriff Bibliothekstantieme nicht genannt wird.
Vergütungspflicht nach § 27 Abs. 2 UrhG:
„Für das Verleihen von Originalen oder Vervielfältigungsstücken eines Werkes, deren Weiterverbreitung nach § 17 Abs. 2 zulässig ist, ist dem Urheber eine angemessene Vergütung zu zahlen, wenn die Originale oder Vervielfältigungsstücke durch eine der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtung (Bücherei, Sammlung von Bild- oder Tonträgern oder anderer Originale oder Vervielfältigungsstücke) verliehen werden. Verleihen im Sinne von Satz 1 ist die zeitlich begrenzte, weder unmittelbar noch mittelbar Erwerbszwecken dienende Gebrauchsüberlassung; […]“
Vergütungspflicht: öffentlich zugängliche Einrichtungen, die systematisch urheberrechtlich geschützte Werke verleihenDie gesetzliche Vergütungspflicht gilt für Ausleihen von urheberrechtlich geschützten Werken durch öffentlich zugängliche Einrichtungen, sofern diese weder unmittelbaren noch mittelbaren Erwerbszwecken dienen. Nutzungsgebühren für Bibliotheken gelten nach § 27 Abs. 2 UrhG nicht als kommerzieller Zweck, weil mit ihnen keine Einnahmen erzielt, sondern lediglich die Kosten des Verwaltungsaufwands abgedeckt werden.Siehe Erwägungsgrund 11 der Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums in der kodifizierten Fassung vom 12.12.2006, ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 28–35 [ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/115/oj]. Ob eine Bibliothek staatlich oder privat finanziert wird, ist unerheblich, so dass u. a. auch kirchliche Einrichtungen oder Werkbüchereien, die öffentlich zugänglich sind, von der Bibliothekstantieme erfasst werden.Dünnwald, Rolf, Staats, Robert, 2021: Die Verleihtantieme („Bibliothekstantieme“) in: Loewenheim, Ulrich, Hrsg.: Handbuch des Urheberrechts, 3. Aufl., München: C. H. Beck, ISBN 978-3-406-72083-3, § 92 Rn. 4. Bieten Firmenbibliotheken lediglich Medien für die beruflich veranlasste Nutzung an, unterliegen sie jedoch nicht der Vergütungspflicht.Freudenberg, Christian, 2023, in: Götting, Horst-Peter, Lauber-Rönsberg, Anne, Rauer, Nils (Hrsg.): Beck’-scher Online-Kommentar Urheberrecht (BeckOK Urheberrecht). 37. Edition, Stand: 01.02.2023. München: C. H. Beck, § 27, Rn. 30. Die Präsenznutzung von urheberrechtlich geschützten Werken wird nicht von der Vergütungspflicht umfasst, wie die Vermiet- und Verleihrechtsrichtlinie der Europäischen Union aus dem Jahr 2006 klarstellt.Siehe Erwägungsgrund 10 der Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des Rates zum Vermietrecht und Verleihrecht sowie zu bestimmten dem Urheberrecht verwandten Schutzrechten im Bereich des geistigen Eigentums in der kodifizierten Fassung vom 12.12.2006, ABl. L 376 vom 27.12.2006, S. 28–35 [ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/115/oj].
10.2.9.2.3 Finanzierung
rund 14 Mio. Euro zur Finanzierung der BibliothekstantiemeDie Kosten für die Bibliothekstantieme werden nicht durch die betroffenen bibliothekarischen Einrichtungen selbst getragen, sondern gemeinsam durch Bund (10 %) und Länder (90 %) nach dem Königsteiner Schlüssel finanziert.Gesamtvertrag über die Abgeltung der Ansprüche nach § 27 Abs. 2 UrhG (Bibliothekstantieme), https://www.zentralstelle-bibliothekstantieme.de/fileadmin/zbt/pdf/2022/ZBT_Gesamtvertrag_Bibliothekstantieme_300622.pdf, Zugriff: 13.03.2024. Insgesamt werden für die gesetzlich vorgeschriebenen Vergütungszahlungen jährlich rund 14 Millionen Euro Steuergelder ausgegeben.Ebenda. Die genaue Summe wird in Gesamtverträgen zwischen den 16 Bundesländern, die durch die Kultusministerkonferenz (KMK) vertreten werden, der Bundesrepublik Deutschland, die durch das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) vertreten wird, sowie den Verwertungsgesellschaften, die durch Zentralstelle Bibliothekstantieme (ZBT) vertreten werden, festgelegt. Für die Verhandlungsführung hat die KMK gemeinsam mit dem Bund eine Kommission Bibliothekstantieme gegründet, der fünf Ländervertreter, ein Vertreter der Finanzministerkonferenz, ein Vertreter der Innenministerkonferenz, ein Vertreter des Deutschen Städtetages, ein Vertreter des Deutschen Bibliotheksverbandes sowie die/der KMK-Vorsitzende angehören.Weitere Informationen auf der Website der KMK, https://www.kmk.org/themen/hochschulen/bibliotheken.html, Zugriff: 13.03.2024.
10.2.9.2.4 Ausschüttung durch die VG Wort
Neben Zahlungen an mehrere Verwertungsgesellschaften für die Nutzung von nichttextlichen Mediengattungen durch Bibliotheken geht der Hauptanteil der 14 Mio. Euro an die VG Wort, die das Geld rechtzeitige Meldung an VG Wort ist notwendiganschließend an die bei ihr registrierten Wahrnehmungsberechtigten ausschüttet.Geschäftsbericht 2022 der VG Wort, https://www.vgwort.de/veroeffentlichungen/geschaeftsberichte.html, Zugriff: 13.03.2024. Um als Urheber von der Ausschüttung zu profitieren, müssen alle Sprachwerke mit genauen bibliographischen Angaben über das Portal T.O.M. („Texte Online Melden“) an die VG Wort gemeldet werden.Siehe: https://tom.vgwort.de/portal/index, Zugriff: 13.03.2024. Werke, die bis zum 31. Januar gemeldet worden sind, werden bei der jährlichen Hauptausschüttung für Printmedien berücksichtigt. Wissenschaftliche Werke sowie Fach- und Sachbücher sind nur dann meldefähig, wenn sie zwei Jahre vor der Ausschüttung erschienen sind.Siehe § 48 Verteilungsplan der VG Wort vom 10.12.2022, https://www.vgwort.de/fileadmin/vg-wort/pdf/dokumente/Verteilungsplaene/Verteilungsplan_Dezember_2022.pdf, Zugriff: 13.03.2024.
VG Wort
Die Verwertungsgesellschaft Wort ist ein Wirtschaftsverein unter staatlicher Aufsicht, der die gesetzlichen Vergütungsansprüche für urheberrechtlich geschützte Sprachwerke von rund 300.000 registrierten Autorinnen und Autoren sowie mehr als 9.000 Verlagen wahrnimmt. Diese schließen mit der VG Wort Wahrnehmungsverträge, mit denen sie ihre gesetzlichen Vergütungsansprüche zur treuhänderischen Wahrnehmung auf die Verwertungsgesellschaft übertragen.
Verfahren unterschiedlich in öffentlicher und wissenschaftlicher BibliothekAus historischen Gründen existieren bei der Berechnung und Ausschüttung der Vergütungszahlen zwei komplett unterschiedlichen Verfahrensweisen, je nachdem ob ein urheberrechtlich geschütztes Werk in „allgemeinen öffentlichen Bibliotheken“ oder in „wissenschaftlichen und Fachbibliotheken“ ausgeliehen wurde.Siehe §§ 15 bis 18 Verteilungplan der VG Wort, ebenda. Die VG Wort unterscheidet in ihrem Verteilungsplan, in dem sie die genauen Regeln für die Verteilung der Einnahmen festlegt, zum einen zwischen der Sparte Wissenschaft, zu der Fachzeitschriften, Fach- und Sachbücher zählen, und zum anderen dem Bereich Belletristik, der u. a. auch Kinder- und Jugendbücher, Tageszeitungen, Wochenpresse und Publikumszeitschriften umfasst.
10.2.9.2.5 Vergütung für Ausleihen in Öffentlichen Bibliotheken
maßgeblich: Statistiken von ReferenzbibliothekenPro Ausleihvorgang in Öffentlichen Bibliotheken erhalten Autorinnen und Autoren derzeit rund 3 Cent und Verlage 1,2 Cent.Deutscher Bundestag, 2023: Forderung nach Erhöhung der Bibliothekstantieme, Parlamentsnachricht vom 26.04.2023, heute im Bundestag (hib 310/2023), https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-945224, Zugriff: 13.03.2024. Maßgeblich für die Höhe der Vergütung sind hochgerechnete Ausleihstatistiken aus Öffentlichen Bibliotheken der vergangenen drei Jahre. Dazu werden in 18 nach unterschiedlichen Größen ausgewählten Referenzbibliotheken, die nicht öffentlich bekannt gegeben werden und regelmäßig wechseln, um Manipulationen zu verhindern, die Ausleihstatistiken in Hinblick auf jedes einzelne Werk genau erfasst und dann auf alle Bibliotheken hochgerechnet.Siehe Stellungnahme des Deutschen Bibliotheksverbands e. V. „Ergebnisse der Studie des Netzwerks Autor*innenrechte verdeutlichen: Es ist Zeit für ernsthafte Gespräche über gemeinsame Lösungswege beim E-Lending“ vom 30.05.2022, https://www.bibliotheksverband.de/sites/default/files/2022-05/2022_05_30_dbv_Stellungnahme zur Studie des Netzwerks AutorInnenrechte.pdf, Zugriff: 13.03.2024. Neben dieser jährlichen Ausschüttung findet alle drei Jahren noch zusätzlich eine Sonderausschüttung statt, an der alle Urheber teilnehmen können, auch wenn ihre Werke nicht in den Ausleihstatistiken der Referenzbibliotheken erfasst werden.§ 16 Verteilungsplan der VG Wort vom 10.12.2022, https://www.vgwort.de/fileadmin/vg-wort/pdf/dokumente/Verteilungsplaene/Verteilungsplan_Dezember_2022.pdf, Zugriff: 13.03.2024.
10.2.9.2.6 Vergütung für Ausleihen in wissenschaftlichen Bibliotheken
Anders als in Öffentlichen Bibliotheken werden urheberrechtlich geschützte Werke in der Sparte Wissenschaft nicht jährlich, sondern nur einmalig vergütet.§ 3 Nr. 12 Verteilungsplan der VG Wort, ebenda. Maßgeblich dawissenschaftliche Werke nur einmalig vergütetfür ist, dass die gedruckten Texte im Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK) in mindestens zwei regionalen Verbundsystemen mit mindestens fünf Standorten nachgewiesen sind. Erfüllt ein Buch diese Voraussetzung nicht, ist aber an mindestens drei Bibliotheksstandorten vorhanden oder wurde mindestens hundert Mal zu einem Stückpreis von mindestens 10,00 Euro verkauft, wird das Buch nur zu 50 % vergütet.§ 48 Nr. 2 Verteilungsplan der VG Wort, ebenda. Des Weiteren richtet sich die Höhe der Vergütung auch nach dem Umfang des Werkes, je mehr Seiten ein Buch aufweist, umso höher fällt die keine Vergütung: Werke unter CC-BY-LizenzVergütung aus.Nähere Details siehe § 47 Nr. 7 Verteilungsplan der VG Wort, ebenda. Wer ein Werk unter einer freien Lizenz veröffentlicht, die auch kommerzielle Nutzungen erlaubt, kann nicht an der Ausschüttung der VG Wort teilnehmen.Siehe § 4 Wahrnehmungsvertrag (Muster) der VG Wort, https://www.vgwort.de/fileadmin/vg-wort/pdf/Wahrnehmungsvertrag/Wahrnehmungsvertrag_Muster_Dez_2021.pdf, Zugriff: 13.03.2024.
10.2.9.2.7 Kritik, Diskussion und Ausblick
Seit rund 50 Jahren bietet die Bibliothekstantieme Urhebern und Verlagen, an die ein Drittel der Einnahmen an VerlageDrittel der Einnahmen fließen, eine verlässliche aus Steuergeldern finanzierte Einnahmequelle, über deren Erhöhung und Ausweitung auf E-Medien aktuell diskutiert wird.DEUTSCHER BUNDESTAG, 2023: Forderung nach Erhöhung der Bibliothekstantieme, Parlamentsnachricht vom 26.04.2023, heute im Bundestag (hib 310/2023), https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-945224, Zugriff: 13.03.2024. Dabei erscheinen nicht nur die im Gesamtvertrag Bibliothekstantieme festgelegte Höhe der Pauschalvergütung, sondern auch die Verfahrensweise der Verteilung wenig begründet und transparent, insbesondere die ungleiche Vergütung von wissenschaftlichen und belletristischen Werken. Auch die Beteiligung der Verlage an der Bibliothekstantieme, die bis zu einem Drittel der Einnahmen erhalten, sowie der Umgang mit Open-Access-Publikationen sollte hinterfragt werden. Insgesamt fehlt eine unabhängige, wissenschaftlich fundierte Berechnungsgrundlage, anhand deren sich feststellen ließe, ob und in welchem Umfang bibliothekarische Ausleihen die Verkaufserlöse von Verlagen auf dem Primärmarkt tatsächlich beeinflussen und damit eine entsprechende Erhöhung der Bibliothekstantieme rechtfertigen könnten. Speziell im wissenschaftlichen Bereich sind diesbezüglich Zweifel angebracht. Auch in Bezug auf digitale Medien haben Verlage nach derzeitiger Rechtslage eine sehr gute Verhandlungsposition, ihre finanziellen Verwertungsinteressen vertraglich gegenüber Bibliotheken Ausweitung der Bibliothekstantieme auf E-Mediendurchzusetzen. Solange der Erschöpfungsgrundsatz nicht auf E-Books ausgeweitet wird, damit Bibliotheken diese genauso wie analoge Werke zu durch die Buchpreisbindung festgelegten Preisen erwerben können, gibt es keinen Anlass die Bibliothekstantieme auf elektronische Medien auszuweiten.

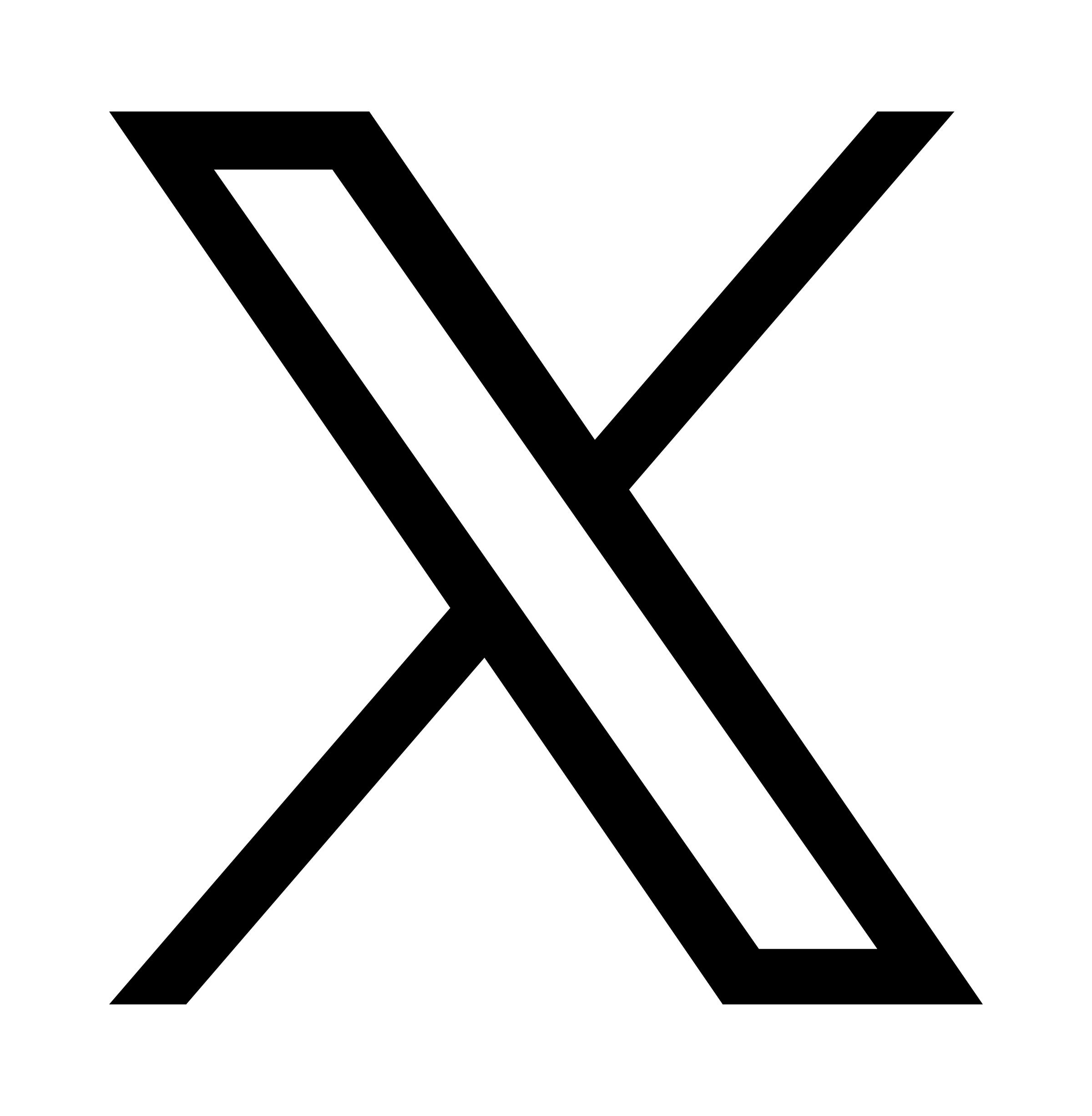 X
X
